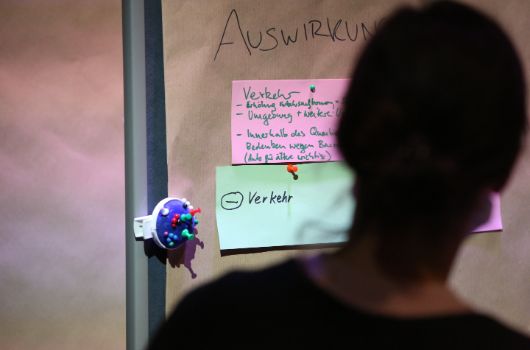PaketPost-Areal: Bürger*innengutachten
112 Münchner*innen haben sich 2021 intensiv mit den Planungen für das PaketPost-Areal auseinandergesetzt. 2022 haben sie die Ergebnisse an die Stadt übergeben.
Anlass, Hintergrund, Verfahren

Das Bürger*innengutachten fürs PaketPost-Areal war in zwei Etappen für jeweils zwei Gruppen angesetzt: vom 5. bis 8. und vom 12. bis 15. Oktober 2021. 112 zufällig aus dem Meldeverzeichnis ausgewählte interessierte Münchner*innen waren ins "Backstage" in Sichtweite der Paketposthalle gekommen, um sich intensiv mit einer der spektakulärsten Planungen der Stadt auseinanderzusetzen. Mit der Durchführung wurde das Berliner Büro nexus Institut beauftragt.
Für das Bürger*innengutachten wurde das laufende Bebauungsplanverfahren unterbrochen, um zu zeigen wie wichtig die Empfehlungen der Teilnehmenden für die weitere Planungen sind.
Anlass und Hintergrund
Seitdem die ersten Planungen für das PaketPost-Areal vorgestellt wurden, steht das Projekt im Fokus der Öffentlichkeit. Besonders kontrovers diskutiert werden die beiden vorgeschlagenen Hochhäuser und die spätere Nutzung der Paketposthalle.
Da diese Fragen nicht nur das Projektumfeld, sondern gesamtstädtische Belange berühren, hat das Referat für Stadtplanung und Bauordnung vorgeschlagen, ein Bürger*innengutachten durchzuführen, um unterschiedliche Perspektiven, Fragestellungen und vorhandene Planungskonflikte zu untersuchen. Besonders wichtig ist zudem die Möglichkeit zur Differenzierung: Es geht nicht um den Versuch, „Schablonen“ für ganz München zu fixieren, sondern um die Suche nach passgenauen Lösungen für eben diesen Standort. Dazu gehört auch die Chance, zielführende Kompromisse und völlig neue Ideenin die Diskussion einzubringen.
Mit dem Bürger*innengutachten soll gewährleistet werden, dass alle Vorschläge und Kritikpunkte zur Entwicklung des neuen Quartiers offen diskutiert werden können.
Das Verfahren
Bei einem Bürger*innengutachten werden Teilnehmer*innen repräsentativ aus dem Melderegister ausgewählt. Sie müssen mindestens 14 Jahre alt sein. In als „Planungszellen“ bezeichneten Arbeitsgruppen diskutieren sie mehrere Tage lang verschiedene Themen. Das Zufallsverfahren gewährleistet, dass alle die gleichen Chancen haben und ein breites Spektrum unterschiedlicher Menschen mitredet. Das Verfahren des Bürger*innengutachtens ist für die öffentliche Debatte wichtiger Planungsthemen besonders geeignet, da es eine Einbindung der „schweigenden Mehrheit“ gewährleistet, die nicht in Initiativen oder politischen Gruppierungen organisiert ist. Zudem ermöglicht es eine konstruktive und kreative Auseinandersetzung mit dem Projekt - abseits eines reinen Ja-Nein-Schemas.
Die Organisation und Durchführung des Verfahrens durch ein unabhängiges Büro ist fester Bestandteil des Konzepts. Dieses soll keinen Einfluss auf das Verfahren und die Ergebnisse nehmen.
Wichtig für eine differenzierte Meinungsbildung und einen offenen Dialog ist, dass die Beteiligten vielfältig informiert werden und auf die Vielzahl unterschiedlicher Aspekte und Perspektiven eingegangen wird. Auch Planungskonflikte werden offen thematisiert. Aus ihnen erarbeiten die Bürger*innen unter Unterstützung des neutralen Durchführenden Entscheidungsalternativen, die anschließend bewertet werden. Ziel ist es, Vorschläge zur weiteren Entwicklung zu erarbeiten und in einem Gutachten festzuhalten.
Ergebnis

Mehr als 80 Seiten, ein ganzer Katalog an wichtigen Forderungen und Anregungen – am 11. Februar 2022 hat eine Delegation aus dem 112 Köpfe starken Team ihr Gutachten zum Neuhauser PaketPost-Areal an Bürgermeisterin Katrin Habenschaden überreicht. Kernaussage: ein klares Ja zu den Plänen für ein neues Wohn- und Geschäftsviertel, aber an manchen Stellen gibt es noch Verbesserungsbedarf.
Die Empfehlungen im Speziellen:
Ein nachhaltiges Quartier schaffen
Das PaketPost-Areal soll besonders ökologisch und klimafreundlich werden – das betrifft sowohl die Gebäude als auch das Mobilitätskonzept. Das neue Quartier an der Friedenheimer Brücke könnte so zur überregional bekannten „Marke“, zum Vorbild werden. Wichtig wären:
- eine nachhaltige Bauweise auf Basis des Platin-Standards der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
- ökologische Baustoffe auf dem zur Bauzeit aktuellen Stand der Technik
- wenig Autoverkehr und ein verringertes Parkplatzangebot
- E-Mobilität und Sharing-Konzepte
- ein intelligentes Parkraummanagement
- gute Angebote für Radfahrer*innen - aber ohne Beeinträchtigung der Fußgänger*innen: durch unterirdische Velo-Zufahrten und separate Fahrradschnellwege.
Grün- und Freiflächen bereitstellen
In den Außenbereichen sollte es mehr attraktiv gestaltete Grün- und Freiflächen geben. Die Balance zwischen bebauten und freien Flächen muss gewahrt sein. Hochwertige Grünflächen außerhalb des eigentlichen PaketPost-Areals in unmittelbarer Nähe wären eine denkbare Alternative, nicht aber die Vorzugslösung. Die Ergebnisse im Einzelnen:
- mindestens 20 Quadratmeter Freifläche pro Person
- Freiflächen haben Priorität vor Bebauung – aber möglichst nicht auf Kosten von Wohnungen. Lösungsidee: höhere Wohnblöcke oder ein weiteres Hochhaus
- Vor der Paketposthalle wäre ein Vorplatz schön
- Die Freifläche in der Paketposthalle (mindestens 18.000 Quadratmeter) darf nicht durch kommerzielle Nutzungen verkleinert werden.
Masterplan weiterentwickeln
Zwar sind sich nicht alle Gutachter*innen einig, ob der aktuelle Masterplan die bestmögliche Variante für das Areal darstellt. Eine Mehrheit empfiehlt dennoch, die weitere Planung auf diesem Konzept aufzubauen – einschließlich des Baus der beiden Hochhäuser. Insgesamt erwartet die Mehrheit einen hohen Nutzen, wenn der Masterplan weiterverfolgt wird. Besonders wichtig sind:
- bezahlbare Wohnungen in größerer Zahl als es die städtischen Mindestvorgaben der sozialgerechten Bodennutzung (SoBoN) vorsehen
- keine Fixierung auf Luxuswohnungen, sondern vor allem auf Wohnungen im mittleren Preissegment, die durch gute Wohnungszuschnitte auch für Menschen mit Durchschnittseinkommen in Frage kommen
- Nein zum alten, aber derzeit noch gültigen Bebauungsplan, der Gewerbe und Bürobauten an der Wilhelm-Hale-Straße vorsieht.
- Ja zu Hochhäusern, aber vielleicht müssen sie überarbeitet werden
- Die Mehrheit der Gutachter*innen befürwortet den Bau von zwei 155 Meter hohen Türmen. Uneinigkeit herrscht über die Gestaltung: Dem einen Teil gefällt der Entwurf des Schweizer Büros Herzog & de Meuron, der andere empfiehlt einen Architekturwettbewerb.
Nutzung und Betrieb der Paketposthalle klären
Die Idee, die Paketposthalle auf Dauer als öffentlichen Treffpunkt und Freiraum zu nutzen, stößt auf breite Zustimmung. Notwendig dafür sind:
- ein Konzept für Gestaltung und Nutzung der Halle: Wer ist Träger der Erdgeschossflächen? Wie genau sollen Erd- und Untergeschoss genutzt werden? Wer trägt das finanzielle Risiko?
- ein organisatorischer Rahmen für den Kulturbetrieb. Vorschlag: Das soll die Stadt München übernehmen – durch die Gründung eines Vereins oder einer Interessensgemeinschaft
- Die Nutzungsrechte für die Öffentlichkeit sollen im Grundbuch festgeschrieben werden.
Informationen für die Öffentlichkeit
Um einseitige Berichterstattung in den Medien besser einordnen zu können, sollen noch mehr fundierte Hintergrundinformationen zur Verfügung gestellt werden. Dazu gehören auch:
- eine Darstellung der von den Gutachter*innen abgelehnten Alternative zum neuen Masterplan: Bürohäuser entlang der Wilhelm-Hale-Straße, wie sie der aktuelle gültige Bebauungsplan ermöglicht
- eine klare Position der Stadt München zur Entwicklung des PaketPost-Areals. Sie sollte möglichst bald fixiert und öffentlich kommuniziert werden.
Zitate zum Bürger*innengutachten

Zitat Oberbürgermeister Dieter Reiter
„Seriös und ausgewogen informieren, intensiv diskutieren und dann mit fundierter Meinung abstimmen: Das ist das Prinzip des Bürger*innengutachtens, und ich finde, der Aufwand hat sich gelohnt. Hier wurde nicht aus dem Bauch heraus entschieden, es ging nicht um ein simples Ja oder Nein. Hier haben Münchner*innen kreativ und mit großem Engagement ihre eigene Stadt mitgeplant.
Und ich freue mich, dass sie sich auch mehrheitlich offen gezeigt haben, für eine Architektur, die innovativ ist und mehr Höhe wagt. Das heißt, dass moderne Akzente im Stadtbild durchaus erwünscht sind – wenn der Standort stimmt. Ich kann mir Hochhäuser für München gut vorstellen, das habe ich immer gesagt, nicht überall in unserer Stadt, aber beispielsweise hier im Zusammenspiel mit der Paketposthalle. Ich bedanke mich bei allen für diesen bemerkenswerten Einsatz. Auf dieser Basis des Gutachtens werden wir nun weiterplanen.“
„Bürgerbeteiligung auf Augenhöhe bedeutet die Bereitschaft auf beiden Seiten, sich auf Konsens zu fokussieren und trotzdem einen Dissens zuzulassen – zugunsten einer gemeinsamen Zieldefinition.“
Weitere Details zum Bürger*innengutachten
Fachvorträge zur Information
Dazu gehörten zunächst Fakten als Basis jeder weiterführenden Diskussion. Zu Beginn jeder Arbeitseinheit gab es einen fachlichen „Input“ – in Form mehrerer Vorträge. Der Masterplan für das gesamte Areal, auf dem neben den beiden diskutierten Hochhäusern noch viele weitere Gebäude mit unterschiedlichen Nutzungen geplant sind, wurde vorgestellt. Es ging um Nachhaltigkeit, um soziale Ausgewogenheit, die Gestaltung der Freiflächen sowie die künftige Nutzung der denkmalgeschützten Paketposthalle selbst, deren beeindruckende Architektur die Teilnehmer*innen bei einem ausgiebigen Rundgang besichtigen konnten. Nach den Vorträgen verteilten sich die Gutachter*innen auf die Tische, um in kleineren Gruppen weiterzudebattieren. Die Ergebnisse wurden später im Plenum vorgestellt und von allen bewertet.
Das auf mehrere Tage angesetzte Bürger*innengutachten, das im Auftrag des Referats für Stadtplanung und Bauordnung ganz bewusst von einem neutralen Ausrichter organisiert wurde, zählt zu den vielversprechendsten, aber auch aufwändigsten Varianten der Öffentlichkeitsbeteiligung. Die Methode ist international anerkannt. Da die Teilnehmer*innen per Zufallsauswahl aus dem Melderegister ausgewählt wurden, ist in den sogenannten Planungszellen ein breiter Querschnitt der Stadtbevölkerung vertreten – wichtig bei einer Planung, die für ganz München von großer Bedeutung ist. Die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema gewährleistet eine fundierte Meinungsbildung und eine entsprechend hochkarätige Debatte mit vielen wertvollen Vorschlägen.
Chance zur Differenzierung
Im Fokus der Teilnehmer*innen standen vor allem das Angebot an Freiräumen im Areal, die nachhaltige Gestaltung des gesamten Areals und die möglichen Nutzungen sowie der Betrieb der Paketposthalle. Besonders wichtig am Bürger*innengutachten ist die Möglichkeit zur Differenzierung: Es geht nicht um den Versuch, „Schablonen“ für ganz München zu fixieren, sondern um die Suche nach passgenauen Lösungen für eben diesen Standort. Dazu gehört auch die Chance, zielführende Kompromisse und völlig neue Ideen in die Diskussion einzubringen. Ein einfaches Ja-Nein-Schema könnte diesen Anspruch nicht erfüllen.
Intensive Auseinandersetzung
Die Themen, mit denen sich die Planungszellen beschäftigten, waren im Juli bei einem Auftakt- und Informationsabend und einem Runden Tisch gesammelt worden. Sie reichten von Bebauungsdichte, Denkmalschutz und Nachhaltigkeit des Areals und der Hochhäuser bis hin zu Nutzung der Paketposthalle und der Freiflächen. Damit diese Themen aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet werden konnten, hielten Expert*innen ausführliche und durchaus auch kontroverse Vorträge – unter anderem die frühere Berliner Senatsbaudirektorin Regula Lüscher sowie Vertreter*innen des Münchner Forums, der Universitäten, des Landesamts für Denkmalpflege, der Münchner Stadtverwaltung, diverser mit dem Thema befasster Ingenieurbüros und von unabhängigen Planungs- und Architekturbüros aus Deutschland und der Schweiz. Bei der auf die Vorträge folgenden Arbeit in Kleingruppen beleuchteten die Gutachter die unterschiedlichen Aspekte und entwickelten eigene Ideen sowie konkrete Vorschläge für die weitere Entwicklung des Areals. Diese wurden anschließend vor der gesamten Gruppe präsentiert, diskutiert und bewertet.
Details zur Arbeit der Planungszellen hat Stadtbaurätin Prof. Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk am 28. September bei einer Pressekonferenz gemeinsam mit Anna Hanusch, Stadträtin und Vorsitzende des Bezirksausschusses Neuhausen-Nymphenburg, Prof. Dr. Christiane Dienel vom nexus-Institut und Investor Ralf Büschl von der Büschl Unternehmensgruppe vorgestellt.
Das Verfahren
Bei einem Bürger*innengutachten werden Teilnehmer*innen repräsentativ aus dem Melderegister ausgewählt. Sie müssen mindestens 14 Jahre alt sein. In als „Planungszellen“ bezeichneten Arbeitsgruppen diskutieren sie mehrere Tage lang verschiedene Themen. Das Zufallsverfahren gewährleistet, dass alle die gleichen Chancen haben und ein breites Spektrum unterschiedlicher Menschen mitredet. Das Verfahren des Bürger*innengutachtens ist für die öffentliche Debatte wichtiger Planungsthemen besonders geeignet, da es eine Einbindung der „schweigenden Mehrheit“ gewährleistet, die nicht in Initiativen oder politischen Gruppierungen organisiert ist. Zudem ermöglicht es eine konstruktive und kreative Auseinandersetzung mit dem Projekt - abseits eines reinen Ja-Nein-Schemas.
Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Durchführung eines Bürger*innengutachtens ist die klare Definition der Aufgabenstellung und des Arbeitsrahmens. Einzuhaltende Rahmenbedingungen wie Gremienvorbehalte oder rechtliche Zwänge müssen klar kommuniziert werden. Die Organisation und Durchführung des Verfahrens durch ein unabhängiges Büro ist fester Bestandteil des Konzepts. Dieses soll keinen Einfluss auf das Verfahren und die Ergebnisse nehmen.
Wichtig für eine differenzierte Meinungsbildung und einen offenen Dialog ist, dass die Beteiligten vielfältig informiert werden und auf die Vielzahl unterschiedlicher Aspekte und Perspektiven eingegangen wird. Auch Planungskonflikte werden offen thematisiert. Aus ihnen erarbeiten die Bürger*innen unter Unterstützung des neutralen Durchführenden Entscheidungsalternativen, die anschließend bewertet werden. Ziel ist es, Vorschläge zur weiteren Entwicklung zu erarbeiten und in einem Gutachten festzuhalten.
Seitdem die ersten Planungen für das PaketPost-Areal vorgestellt wurden, steht das Projekt im Fokus der Öffentlichkeit. Besonders kontrovers diskutiert werden die beiden vorgeschlagenen Hochhäuser und die spätere Nutzung der Paketposthalle.
Da diese Fragen nicht nur das Projektumfeld, sondern gesamtstädtische Belange berühren, hat das Referat für Stadtplanung und Bauordnung vorgeschlagen, ein Bürger*innengutachten durchzuführen, um unterschiedliche Perspektiven, Fragestellungen und vorhandene Planungskonflikte zu untersuchen. Besonders wichtig ist zudem die Möglichkeit zur Differenzierung: Es geht nicht um den Versuch, „Schablonen“ für ganz München zu fixieren, sondern um die Suche nach passgenauen Lösungen für eben diesen Standort. Dazu gehört auch die Chance, zielführende Kompromisse und völlig neue Ideenin die Diskussion einzubringen.
Mit dem Bürger*innengutachten soll gewährleistet werden, dass alle Vorschläge und Kritikpunkte zur Entwicklung des neuen Quartiers offen diskutiert werden können.
Das erste Münchner Bürgergutachten fand 2013 statt. Das Kunstareal wurde untersucht, zahlreiche der Vorschläge wurden verwirklicht, beispielsweise die Wiederbesetzung einer Koordinationsstelle oder die Ausschreibung eines Masterplans zur Grün- und Freiraumgestaltung.
Das jüngste Bürgergutachten in München wurde 2017 zum Viktualienmarkt durchgeführt. Hier fand das Verfahren etwa in der Mitte des Planungsprozesses statt, sodass es bereits Ergebnisse von Architekt*innen und Planer*innen gab. Der Prozess war allerdings noch so offen, dass die Bürger*innen eingreifen und mit ihren wichtigen Empfehlungen die Zukunft und Sanierung des Münchner Viktualienmarkts mitgestalten konnten.
Chronologie
02/2022 Übergabe des Bürger*innengutachtens an Oberbürgermeister Dieter Reiter
10/2021 Termine für die Planungszellen des Bürger*innengutachtens
28.9.2021 Pressekonferenz zum Start der Planungszellen
1.7.2021 Infoveranstaltung und Auftakt Bürgergutachten
05/2021 Vergabe Durchführung Bürgergutachten an nexus – Institut für Kooperationsmanagement und interdisziplinäre Forschung, Berlin
04/2021 Bekanntgabe Bürgergutachten im Planungsausschuss
01/2021 Vergabebeschluss für das Bürgergutachten durch den Stadtrat